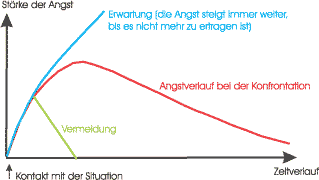„Wie soll das eigentlich weiter gehen?“ Ein Gedanke, der mich den ganzen Klinikaufenthalt lang begleitet. In der Therapie läuft es gut, ich bin der Vorzeigepatient und verstehe kognitiv genau, was mit mir passiert. An meinen Wochenenden zu Hause aber läuft es … unstabil. Die Sorge vor unruhigen Nächten und die Wut darüber, es „wieder mal nicht geschafft zu haben“ ist immer noch da. Und jetzt? Auf immer und ewig werde ich mich nicht in der Psychoklinik verschanzen können. Irgendwann muss ich wieder zurück ins „richtige Leben“. Wie soll ich das jemals schaffen? Die Antwort: Das Leben findet seinen Weg.
In meinem Fall ist dieser Weg unerwartet und heißt „Bindehautentzündung“. Weiß der Henker, woher sie kommt. Tatsache ist: es hat mich schwer erwischt. Mein linkes Auge ist rot, es tut weh und es passieren Dinge, die ich dem geneigten Leser angesichts eines möglicherweise anstehenden Mittag- oder Abendessens lieber ersparen möchte. Während ich langsam zu einem Augen-Alien mutiere beschert mir eine Untersuchung in der hiesigen Uniklinik die Erkenntnis: das, was ich da habe, könnte ansteckend sein. Und „ansteckend“ bedeutet: entweder tagelange „Augen-Quarantäne“ in meinem Einzelzimmer oder raus aus der Psychoklinik, damit andere Patienten vor meinem Viren-Debakel verschont bleiben.

Wie soll das klappen?
Da ist sie also, die Situation, vor der ich panische Angst habe: raus aus der Klinik. Ungeplant und überstürzt. Zumindest bis klar ist, auf welche Art von Virus mein Auge ein Auge geworfen hat. Bis dahin ohne Möglichkeit der Rückkehr in mein sicheres Refugium, in dem derzeit die Welt in Ordnung ist. Was soll ich nur tun? Wie soll ich das schaffen? Ich packe meinen Koffer in der Psychoklinik und stopfe eine gehörige Portion Panik zwischen Wäsche und Kulturtasche.
Natürlich freue ich mich, meinen Mann wieder zu sehen. Und doch bedeutet es: ich muss mich meinen Dämonen stellen. Aus therapeutischer Theorie wird ungeplant früh panische Praxis. Und die hält eine Überraschung parat: Die erste Nacht klappt erstaunlich gut. Was in meiner absurden Gedankenwelt den Druck auf die zweite Nacht leider erhöht: Wird es wieder so gut sein? Oder bleibt es ein Einzelfall? Ich bitte meinen Mann am zweiten Abend um eine meiner „Notfalltabletten“ aus alten Tagen, weil ich mich den ganzen Tag lang kribbelig fühle und ich dieses Gefühl nicht weg kriege. Wobei ich mir attestieren muss, dass ich auch nicht alle in der Klinik gelernten Möglichkeiten versuche. Egal, eine Tablette ist erlaubt. Mein Mann gibt sie mir zögerlich und ist ein wenig sauer auf mich, weil er merkt, dass ich mich hängen lasse. Trotzdem: die zweite Nacht klappt auch.
Bedrohliche Dämonen
Die dritte Nacht beginnt wieder kribbelig, doch bin ich gedanklich so bei meinem Mutanten-Auge, dass dieser Gedanke letztendlich wichtiger ist als die Sorge um meinen Schlaf. Ich brauche zwar länger zum einschlafen, aber auch dieses mal klappt es. Und Nacht Nummer 4? Ich mache vorher Entspannungsübungen, wie ich sie ohnehin „eigentlich“ jeden Tag machen will. Die Nacht ist dann kein Problem. Umdrehen. Schlafen. Und warum? Weil ich merke, dass ich aufhöre, meine Gedankenkreise um meinen Schlaf zum Dauerthema zu machen und darauf zu vertrauen, dass mein Körper es schon schaffen wird. Irgendwoher kommt die Zuversicht.

Eine weitere Untersuchung am darauf folgenden Tag an der Uniklinik macht klar, dass mein martialisch aussehendes Rot-Auge zwar nervig, aber nicht ansteckend ist. Ich könnte also zurück in die Psycho-Klinik. Zurück in meine sichere Welt zwischen Psycho-, Tanz- und Kunsttherapie. In die Welt also, die vor vier Tagen noch wichtig für mich war. Und von der ich vier Tage später merke, dass sie völlig unbemerkt ihre positiven Spuren in meiner Psyche hinterlassen hat.
Ein unerwartete Entscheidung
Ich fasse einen mutigen Entschluss: ja, ich gehe zurück in die Klinik. Aber nur noch für eine Woche. Um einen ordentlichen Abschluss zu finden. Um mit allen Therapeuten noch mal finale Gespräche zu führen und alles für mich zusammen zu fassen. Und während ich dies hier schreibe stelle ich fest, dass sich zwei Monate Psychoklinik auf ein paar banale Erkenntnisse reduzieren: Manche Dinge werden erst dann gut, wen Du aufhörst, sie kontrollieren zu wollen. Vertraue auf Dich und Deinen Körper. Und: erzähle nicht immer nur davon, deine Glaubenssätze ändern zu wollen, sondern sei wirklich dazu bereit.
Ein paar einfache Sätze, zu denen in Zukunft sicher noch ein paar mehr dazu kommen werden. Und doch war es ein langer Weg dorthin. Der Weg ist immer noch auf sandigem Boden gebaut und vermutlich werde ich noch viele Male kämpfen müssen, um nicht im weichen Untergrund einzusinken. Aber hey, so ist der Deal: Die Therapie in der Klinik gibt die Richtung vor. Die Landkarte schreibst Du selbst. Und gehen musst du allein.
Oder wie ein lieber Mitpatient es formuliert hat: Der Zug der dich überfährt, wird von Dir gesteuert. Von keinem anderen sonst.